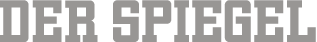- Diesen Artikel vollstÀndig lesen.
- Eine Nacht darĂŒber schlafen.
- AnschlieĂend mit eigener Erfahrung und den anderen Artikeln vergleichen.
- SchluĂfolgerungen ziehen. Auf den AHA-Effekt warten.

Aus Warschau berichtet Nadia Pantel
18.08.2024, 07.52 Uhr o aus DER SPIEGEL 34/2024

Wie diese Geschichte entstanden ist
Zum ersten Mal besichtigte Reporterin Nadia Pantel (r.) den Warschauer Kulturpalast vor 20 Jahren bei einer Exkursion im Geschichtsstudium.
Sie lernte: Dieser Turm kommt von Stalin und erinnert die Polen daran, welche Gefahr von Russland ausgehen kann. Als Pantel 2013 nach Warschau zurĂŒckkehrte, stand sie auf einmal zwischen lauter Tanzenden auf dem Vorplatz des Palasts. Hier finde man die besten Partys, wurde ihr erklĂ€rt.
FĂŒr den SPIEGEL ging sie nun den WidersprĂŒchen dieses GebĂ€udes auf den Grund. DafĂŒr sprach sie unter anderem mit der 88-jĂ€hrigen Schauspielerin Irena Jun, die alle Höhepunkte ihrer Karriere im Kulturpalast feierte und die ĂŒber ihn sagt: "Er ist wie ein Verwandter vom Dorf, geschmacklos gekleidet und auffĂ€llig grobschlĂ€chtig." "Der Turm", sagt Pantel, "ist von einem Symbol der sowjetischen UnterdrĂŒckung zu einem Symbol der Energie und Widerstandskraft geworden, die Warschau ausmachen."

Foto: Jedrzej Nowicki / DER SPIEGEL
Ganz oben gehört der Palast den Greifvögeln. An der TĂŒr, die zur Turmuhr fĂŒhrt, hĂ€ngt ein Zettel: "Bitte verhalten Sie sich ruhig, Wanderfalken schlĂŒpfen". Man schaut also schweigend hinunter auf Warschau, auf Wolkenkratzer und auf WohntĂŒrme, die mit 20 Stockwerken klein wirken.
Erst hier oben spĂŒrt man, dass dieses GebĂ€ude nicht nur hoch ist, sondern ĂŒbertrieben hoch. 44 Stockwerke, 230,68 Meter.

Foto: Jedrzej Nowicki / DER SPIEGEL
Bei seiner Eröffnung 1955 war es das achthöchste GebĂ€ude der Welt. Der Warschauer Kulturpalast ragt nicht etwa so steil hinauf, weil auf dem Boden der Platz knapp gewesen wĂ€re, sondern weil er den Betrachter ĂŒberwĂ€ltigen sollte. Als 1952 die Bauarbeiten begannen, waren nach der deutschen Besatzung die HĂ€user und StraĂen der Stadt fast vollstĂ€ndig zerstört. Und mitten in eine WĂŒste aus Schutt und Staub wurde ein Turm gepflanzt, den noch heute manche so beschreiben, wie er möglicherweise gemeint war: als einen gigantischen Mittelfinger. Eine imperiale Ăberlegenheitsgeste, ein sogenanntes Freundschaftsgeschenk - von Sowjetherrscher Josef Stalin persönlich.
Ein Teufel von einem Turm - könnte man meinen. Bis man einen Warschauer Souvenirladen betritt und ĂŒberall seine hohe, schmale Silhouette sieht. Der Kulturpalast wird auf Magnete und Socken gedruckt, auf Postkarten, NotizbĂŒcher und Kaffeetassen. Alle hassen Stalin, aber jeder liebt sein Haus?
40 Stockwerke unter den Wanderfalken lĂ€uft der Sportlehrer Bart?omiej Krynicki auf FischgrĂ€tparkett von der Musicalprobe zur Rollschuhbahn und sagt: "Wer glaubt, man mĂŒsse den Palast abreiĂen, hat nichts verstanden." Krynicki joggt fast, er hat wenig Zeit und will alles zeigen. Die TheaterbĂŒhnen, die Bibliothek, die Sporthallen, die WerkstĂ€tten und schlieĂlich das HerzstĂŒck: ein von MarmortribĂŒnen eingefasster Swimmingpool, 4,80 Meter tief. Krynicki hat hier seinen Tauchlehrerschein gemacht. Vom Zehnmetersprungturm blickt man auf golden gerahmte, raumhohe SĂ€ulen. Es sieht aus, als hĂ€tte jemand einen Ballsaal mit Wasser gefĂŒllt.

Foto: Jedrzej Nowicki / DER SPIEGEL
Seit zwei Jahren leitet der 52-jĂ€hrige Krynicki den "Palast der Jugend", der einen der SeitenflĂŒgel des GebĂ€udes ausfĂŒllt. Tausende Kinder besuchen dort erschwingliche Musik-, Sport- und Theaterkurse, öffentlich subventioniert. Krynicki hat hier vor mehr als 40 Jahren schwimmen gelernt und ist als Jugendlicher mit dem palasteigenen Fahrschulauto durch Warschau gefahren. "FĂŒr viele Familien ist der Palast seit Generationen ein Zuhause", sagt Krynicki und erzĂ€hlt, dass er manchmal barfuĂ ĂŒber den HolzfuĂboden geht, weil er sich hier so wohlfĂŒhlt. NatĂŒrlich wisse er, dass Stalin den Palast bauen lieĂ, aber heute gehöre er keinem Diktator, sondern Menschen wie ihm.
Der Eiffelturm mag bekannter sein, das Kolosseum ist Ă€lter, der Turm von Pisa ist zweifellos schiefer. Aber keines dieser Bauwerke erzĂ€hlt so viel von der jĂŒngeren europĂ€ischen Vergangenheit wie der Kulturpalast. Vom Trauma des Krieges und vom Wiederaufbau, von deutscher Verheerung, russischer Aggression und polnischem Widerstandsgeist. Von den Wildwestjahren des Kapitalismus der Neunzigerjahre und davon, wie die polnische Zivilgesellschaft von 2015 bis 2023 gegen den dumpfen Nationalismus der PiS-Regierung kĂ€mpfte.

Foto: Jedrzej Nowicki / DER SPIEGEL
Der Kulturpalast ist eine Stadt. Nur eben eine vertikale, alles stapelt sich ĂŒbereinander. Vielleicht sollte jemand einen Panoramafahrstuhl bauen, mit dem man an den SehenswĂŒrdigkeiten des Palastes vorbeigleiten kann. So wie die MiniaturzĂŒge, die durch TouristenstĂ€dte fahren. Attraktion links, Attraktion rechts, bitte sitzen bleiben.
Beginnt man im zweiten Kellergeschoss, riecht es zunĂ€chst nach Katzenurin. Acht Palastkatzen kontrollieren die Nagetierpopulation. Hinter dem Katzenklo liegt der Eingang zu einem improvisierten Museum. Ein Mitarbeiter der Verwaltung hat Vitrinen aufgestellt, dort lagert die Schere, mit der das rote Band am Eröffnungstag durchgeschnitten wurde. AuĂerdem ein GĂ€stebuch mit einem Eintrag von 1956: "Alle sind von dem groĂen Prachtwerk ĂŒberwĂ€ltigt." Unterzeichnet von der "Pionierdelegation der Antifaschistischen WiderstandskĂ€mpfer" aus der DDR. Neben den SchaukĂ€sten stehen einige der StĂŒhle, auf denen die Menschen saĂen, die sich 1967 im Kulturpalast die Rolling Stones anhörten. Es gibt kein Hinweisschild fĂŒr dieses Museum, es ist eher ein liebevoll kuratierter Abstellraum. Verirrt man sich dorthin, hĂ€lt einen niemanden auf.

Foto: Jedrzej Nowicki / DER SPIEGEL
Ăhnliches gilt fĂŒr die PrunksĂ€le im zweiten und vierten Stock. Das Parkett ist in Sternmustern gelegt, die Schritte hallen. Inmitten welcher anderen europĂ€ischen Hauptstadt darf derart viel Platz und Pomp vor sich hin schlafen?
Will man es wuseliger, geht man zur Postfiliale im ersten Stock. Oder ins Evolutionsmuseum, ins Technikmuseum, in die Spinnenaustellung. Auf 44 Stockwerken verteilen sich vier Theater, die Hochschule fĂŒr angewandte Wissenschaften, die Akademie fĂŒr Fotografie, die PrivatuniversitĂ€t Collegium Civitas, eine Medienhochschule und sieben CafĂ©s, Bars und Restaurants. AuĂerdem 70.000 Quadratmeter BĂŒroflĂ€che und 40 KonferenzsĂ€le. Im Untergeschoss befindet sich ein Kino. Dort saĂen im vergangenen Dezember die Warschauer zu Hunderten und schauten sich eine LiveĂŒbertragung aus dem polnischen Parlament an. Als Donald Tusk als neuer Premierminister vereidigt wurde, jubelte der ganze Kinosaal.
Der Palast war 2015 nach dem Wahlsieg der rechtspopulistischen PiS zum Fixpunkt der Opposition geworden. Auf dem riesigen Vorplatz demonstrierte eine neu erstarkte Frauenbewegung gegen das Abtreibungsverbot und fĂŒr den Rechtsstaat. Die Palastfassade wurde zur Leinwand auf die mal eine Regenbogenfahne, mal ein roter Blitz projiziert wurde, das Symbol des "Frauenstreiks". 2017 kippte der Protest ins AbgrĂŒndige: Piotr S. , 54, zĂŒndete sich auf dem Vorplatz an und starb. Er wollte seine Tat als politischen Widerstand gegen die PiS-Regierung verstanden wissen. Nachdem die Koalition um Tusk 2023 die Regierung ĂŒbernahm, leuchtete das GebĂ€ude rot und weiĂ, wie sonst nur an Nationalfeiertagen. Dazu verkĂŒndete der Turm auf seinem Facebook-Profil: "Es ist Zeit fĂŒr ein glĂŒckliches Polen."

Foto: Jedrzej Nowicki / DER SPIEGEL
Dabei kann man dem Palast nicht vorwerfen, allzu eng mit der neuen Regierung befreundet zu sein. Der aktuelle AuĂenminister und Tusk-Vertraute Radoslaw Sikorski fordert seit Jahrzehnten, dass man das GebĂ€ude abreiĂen mĂŒsse. Zum einen fresse es so viel Strom wie eine Stadt mit 30.000 Einwohnern. Zum anderen könne seine Zerstörung einen "Moment der Katharsis" herbeifĂŒhren, der Polen von seiner kommunistischen Vergangenheit erlöse.
TatsÀchlich stellte sich 2022 nach Russlands Ukraineinvasion die Frage neu, wie politisch der Sandsteinriese ist: Putin bekÀmpft die Ukraine, weil er sich weigert, ihre UnabhÀngigkeit anzuerkennen. Stalin lieà den Kulturpalast bauen, um Warschau als Teil des sowjetischen Blocks zu markieren. Nach dem Angriff auf Kiew hÀtte der Kulturpalast wie ein vergifteter Anker wirken können, wie etwas, das Warschau auch nach Jahrzehnten noch an Moskau kettet.
Doch der Palast hat sich lĂ€ngst befreit. Als die ersten FlĂŒchtenden aus der Ukraine mit dem Zug am Hauptbahnhof von Warschau ankamen, lieĂ die Verwaltung des Kulturpalastes das GebĂ€ude blau und gelb anstrahlen. Vom Bahnhof zum Kulturpalast sind es nur wenige Hundert Meter. Der Turm wurde zur ersten Anlaufstelle der GeflĂŒchteten, von hier aus wurden Hilfe und Spenden organisiert. Beim Skatepark hinter dem Palast unterhalten sich Jugendliche auf Ukrainisch. Manche haben ihre Namen in die nördliche AuĂenmauer geritzt.
Hinter dieser Mauer befindet sich das Teatr Studio. Dort arbeitet die Schauspielerin Irena Jun. Der Beginn ihrer Karriere liegt beinahe so lange zurĂŒck wie der Bau des Kulturpalastes. Jun betritt den Raum am Arm einer Kollegin und geht dabei so elegant, als hielte sie die stĂŒtzende Hand nur aus Sympathie, nicht weil sie Hilfe braucht. Irena Jun ist 88 Jahre alt, aktuell ist sie in einem Ein-Frau-Abend auf der BĂŒhne zu sehen, in dem sie eine Figur spielt, die zwischen Göttin und Hexe changiert. "Wie schön, dass Sie hier sind", sagt sie.

Foto: Jedrzej Nowicki / DER SPIEGEL
Jun wurde 1935 in der sĂŒdpolnischen Stadt HrubieszĂČw geboren, ihre Schauspielausbildung machte sie in Krakau. Als sie 1970 als junge Frau nach Warschau kam, ging fĂŒr sie ein Traum in ErfĂŒllung: "Es war fĂŒr mich eine heilige Stadt." Die Stadt des Warschauer Aufstands und des Aufstands im Ghetto, ein Ort, an dem man fĂŒr seine WĂŒrde und UnabhĂ€ngigkeit mit dem Tod bezahlen musste. Dieses Erbe lebte in den Herzen der Menschen weiter, im Stadtbild war es wie ausgelöscht. Jun hasste es, wie der Kulturpalast sich in dieser verletzten Stadt breit machte. Es war, sagt sie, als beschmutze er die Erinnerungen an das verschwundene Warschau. Sie nennt den Palast "kontaminiert".
Zugleich wurde der Kulturpalast zu Juns kĂŒnstlerischer Heimat. In den Siebzigerjahren leitete JĂłzef Szajna das Teatr Studio. Seine Inszenierungen waren ein Gegenentwurf zur geistigen Enge der offiziellen Kulturpolitik und tourten durch Westeuropa. An Szajnas Seite arbeitete Jun in einem Haus, das fĂŒr die GröĂe des sozialistischen Staates stehen sollte - und indem sie bestens gelaunt ignorierten, was fĂŒr eine Kunst dieser Staat sich wĂŒnschte. Hier wurde Jun zu einer gefeierten Schauspielerin, zu einer Regisseurin und Autorin. "Wir waren jung, und wir waren stolz auf dieses Theater, wir fĂŒhlten uns gröĂer als dieser Turm", sagt Jun. FĂŒr sie war der Kulturpalast beides: eine Zumutung und, wenigstens im nördlichen FlĂŒgel, ein Paradies. In den RĂ€umen des Besatzers schufen sie sich ihre Freiheit.

Foto: Jedrzej Nowicki / DER SPIEGEL
Wie konnte aus einem verhassten GebĂ€ude das Wahrzeichen einer Stadt werden? Wie konnte dieser Turm seine Geschichte abschĂŒtteln in einem Land, das von historischen ErzĂ€hlungen besessen ist? Diese Fragen trieben den britisch-polnischen Anthropologen Micha? Murawski so sehr um, dass er sich 2009 fĂŒr ein halbes Jahr in einem BĂŒro des Palastes einquartierte. Er erkundete das GebĂ€ude, als wĂ€re es ein fremder Kontinent. 2019 veröffentlichte Murawski das Buch "Der Palastkomplex", das nachzeichnet, wie die Bewohner Warschaus in einem Zickzackkurs aus Ablehnung und Zuneigung dazu verdammt sind, sich ĂŒber ihr VerhĂ€ltnis zum Palast zu definieren.
77 Prozent der Warschauerinnen und Warschauer sagen, dass sie mit dem Palast Kindheitserinnerungen verbinden. 63 Prozent nannten ihn "das wichtigste und am einfachsten zu identifizierende Symbol" der Stadt. Das fand Murawski in einer Umfrage mit 5000 Teilnehmenden heraus.
Murawski fasziniert, dass der Palast genau so genutzt wird, wie es der Name verspricht, nĂ€mlich als "Pa?ac Kultury i Nauki", als Palast der Kultur und Wissenschaft. Das sei möglich, erklĂ€rt er, weil der Palast nie privatisiert wurde. Er gehört der Stadt Warschau. Ăffentliche Bildungs- und Kultureinrichtungen haben hier nicht mit hohen Mieten zu kĂ€mpfen. Die Lage im Zentrum wĂ€re inzwischen unbezahlbar, doch das denkmalgeschĂŒtzte 123.000-Quadratmeter-GebĂ€ude ist fĂŒr Investoren kaum attraktiv.

Foto: Jedrzej Nowicki / DER SPIEGEL
In den Transformationsjahren nach 1989, so beschreibt es Murawski, drehte der Kapitalismus rund um den Palast frei. Wolkenkratzer wurden hochgezogen. Auf dem Vorplatz entstand einer dieser wilden MĂ€rkte, auf denen man von selbst fermentiertem WeiĂkohl ĂŒber gefĂ€lschte Louis-Vuitton-Taschen bis zu Schreckschusspistolen alles kaufen konnte. Der Freizeitpark Cricoland eröffnete und verschwand wieder. Jemand stellte ohne Genehmigung ein sowjetisches Propellerflugzeug vor das GebĂ€ude und nutzte es als Imbissbude. Und im Palast selbst? Nehmen Kinder Ballettunterricht, feiern Regisseure ihre Premieren, werden Möbel nicht je nach Mode ersetzt und weggeworfen, sondern in den hauseigenen WerkstĂ€tten repariert, 1960 genauso wie 2024.
"Der Palast durfte langsamer sein als die Stadt", sagt Murawski. In einem Land, das dem Kommunismus radikal abgeschworen hat, in dem linke Parteien nie Wahlen gewinnen, halte sich vor aller Augen ein Relikt der sozialistischen Ideologie. Kultur und Bildung fĂŒr die Massen, der Traum des lesenden, dichtenden, philosophierenden Arbeiters. So sieht es Murawski, der am University College London lehrt.
In Warschau selbst hört man zur ErklÀrung der Palastliebe weniger ideologische Thesen. Der Palast wurde eingemeindet in einer Mischung aus Pragmatismus, Gewöhnung und, trotz allem, Sympathie. Erstens wÀre es teuer, ihn in die Luft zu sprengen. Zweitens kann sich die Mehrheit der Stadtbewohner inzwischen nicht mehr an ein Warschau ohne Palast erinnern. Und drittens, na ja, ist er nicht doch irgendwie einfach schön? Ein polnisches Empire State Building.
FĂŒnf Minuten FuĂweg davon entfernt liegt das Warschauer BĂŒro fĂŒr Stadtplanung. Die Architekten, die hier arbeiten, blicken nicht nur auf den Palast, sie entwerfen auch seine Zukunft. Dabei ist es nicht so entscheidend, dass es im Palast drinnen manchmal wirkt, als wĂ€re die Zeit stehen geblieben. Es geht darum, die 147.000 Quadratmeter BrachflĂ€che rund um den Turm in die Gegenwart zu holen. Der Plac Defilad ist einer der gröĂten PlĂ€tze Europas und wirkt eher wie ein vergessenes Parkdeck als wie das Herz der Stadt.

Foto: Jedrzej Nowicki / DER SPIEGEL

Foto: Jedrzej Nowicki / DER SPIEGEL
"Das GebĂ€ude ist hier gelandet wie ein völliger Fremdkörper", sagt Stadtplaner Wojciech Kacperski. Er zeigt Bilder der Warschauer Innenstadt von vor dem Zweiten Weltkrieg. Wo heute der Palast steht, lag der am dichtesten besiedelte Teil. Ein "bĂŒrgerliches Viertel" nannten es die sowjetischen Stadtplaner. Es sollte eine Beschimpfung sein. Die HĂ€user, die den Beschuss der Nationalsozialisten ĂŒberstanden hatten, wurden planiert, ihre Besitzer von der sozialistischen Regierung enteignet. "Wir sind immer noch dabei zu verstehen, was alles verschwunden ist", sagt Kacperski.
Derzeit baut die Stadt Warschau einen neuen Park vor den Kulturpalast, im Oktober soll dort das Museum fĂŒr Moderne Kunst einen weiĂen Kastenbau beziehen. Es ist die gröĂte VerĂ€nderung an dieser Stelle seit Eröffnung der Metro in den Neunzigerjahren. Asphalt wurde aufgerissen, Ruinen wurden freigelegt. In der Baugrube sieht man StraĂenbahnschienen und dicht aneinander liegende Fundamente. FrĂŒhere GeschĂ€fte, WohnhĂ€user und, dem Fund vieler kleiner Glasflaschen nach zu urteilen, auch eine Apotheke. Dort, wo gerade nicht umgegraben wird, zeigt eine im Boden versenkte Metalllinie den Verlauf der Grenze um das Warschauer Ghetto von 1940 bis 1943. Das Fundament des Kulturpalastes wurde genau neben den Ort gelegt, an dem die deutschen Besatzer 450.000 Juden einsperrten, quĂ€lten, entmenschlichten und schlieĂlich ermordeten oder deportierten.
Stadtplaner Kacperski empfiehlt, ein altes Tagebuch zu lesen, um sich vorstellen zu können, wie Warschau sich nach dem Krieg anfĂŒhlte. Es sind die Notizen von JĂłzef Sigalin, der als polnischer Architekt maĂgeblich fĂŒr die Planung des Kulturpalastes verantwortlich war. Sigalin war Kommunist aus einer jĂŒdischen Familie, seine Mutter und seine Schwester nahmen sich 1943 in einem GĂŒterzug das Leben - bevor dieser das Vernichtungslager Treblinka erreichte. Sigalin hatte Grauenhaftes gesehen. Aber er wollte an die Zukunft glauben und fĂŒr Polen eine neue Hauptstadt bauen. Eine Fahrt durch Warschau am 18. Januar 1945, einen Tag nachdem die Rote Armee die Stadt fĂŒr befreit erklĂ€rt hatte, beschreibt Sigalin so: "Alle GebĂ€ude sind zerstört, StraĂenbahnen liegen auf der Seite, Zettel hĂ€ngen an Toren, die einmal EingĂ€nge zu HĂ€usern waren. In frĂŒheren Innenhöfen Kreuze, Kreuze. Die Friedhofsmauer scheint ĂŒberflĂŒssig, sie trennt nicht mehr die Lebenden von den Toten." Warschau, eine Stadt in der heute 1,9 Millionen Menschen leben, verlor im Zweiten Weltkrieg 700.000 Einwohner.
Der Kulturpalast thront auf diesen Toten wie ein trotziger Riese, der nicht lĂ€nger daran erinnert werden will, wo er seine FĂŒĂe hingestellt hat. "Es gibt viele Zeugnisse aus den FĂŒnfzigerjahren, die beschreiben, wie brutal und schrecklich die Menschen den Bau des Palasts fanden", sagt Kacperski. "Gleichzeitig glaube ich, dass viele Menschen so dringend auf der Suche nach Hoffnung waren, dass ihnen die sowjetische Propaganda des Neuanfangs geholfen hat."
In dem Park, der gerade entsteht, zeigen FuĂwege, wo frĂŒher StraĂen verliefen. Spuren des Verschwundenen. Und in der Gegenwart der Anlass fĂŒr Streit. Hausbesitzer, die fĂŒr den Bau des Palastes enteignet wurden, können seit 1989 ihre GrundstĂŒcke zurĂŒckfordern. Dass der Kulturpalast bis heute von einer unwirtlichen, verwitterten BetonflĂ€che umgeben ist, liegt auch daran, dass im Chaos der BesitzverhĂ€ltnisse ein Flickenteppich entstanden ist, aus dem die Stadt Warschau sich nur einzelne Fetzen sichern konnte.

Foto: Jedrzej Nowicki / DER SPIEGEL
Besucht man die BĂŒros der Palastverwaltung in einem der oberen Stockwerke, werden einem dort SchokoladentĂ€felchen mit aufgedrucktem Palast angeboten, die aussehen, als lĂ€ge ihre Herstellung ein paar Jahre zurĂŒck. Zwischen plĂŒschigen Sesseln und Zierpalmen fĂ€llt ein Bild ins Auge, das in seiner Coolness nicht ganz in den Raum passt. Es ist das Cover der ersten Ausgabe der "Vogue Polska", erschienen im MĂ€rz 2018. Die polnischen Topmodels Anja Rubik und Malgosia Bela stehen neben einem schwarzen Wolga, hinter ihnen der Kulturpalast. Der Himmel ist grau, vor Belas schwarzem Mantel sind Schneeflocken zu sehen. Das Foto ist von unten aufgenommen, die Beine wirken extralang, die Kiefer extrakantig, und trotz dieser Perspektive hat es der Kulturpalast nicht ganz ins Bild geschafft, seine Spitze ist abgeschnitten und verliert sich ohnehin im Nebel.
Kaum war es erschienen, wurde das Cover zum Skandal. Die Empörungswelle in Kurzform: Da hat Polen einmal die Chance, der Welt zu zeigen, wie schön es ist, und die "Vogue" druckt ein Bild, das aussieht wie eine Kalter-Krieg-Vision von WesteuropÀern. Als hÀtte man Polen schon wieder die Farbe rausgedreht. Und dann auch noch ein schwarzer Wolga - das Lieblingsauto des kommunistischen Geheimdienstes.

Filip Niedenthal klingt halb entschuldigend, als er sagt: "Mir gefĂ€llt dieses Bild immer noch." 2018 war Niedenthal Chefredakteur der "Vogue", das Cover war seine Entscheidung. Er bittet zum Interview in einem CafĂ©, das, wie das so ist im Zentrum von Warschau, zehn FuĂminuten vom Palast entfernt liegt. Niedenthals Vater ist der britisch-polnische Fotograf Chris Niedenthal, dessen Bilder aus den Solidarno??-Jahren weltberĂŒhmt wurden. GewerkschaftsfĂŒhrer Lech Wa??sa, russische Panzer, Alltagsszenen an leeren MarktstĂ€nden. Niedenthals Bilder wurden in "Newsweek", im "Time Magazine" und im SPIEGEL gedruckt. Der Sohn Filip wĂ€chst in Warschau auf, als Kind blĂ€ttert er durch Westzeitschriften, interessiert sich fĂŒr Mode ebenso wie fĂŒr Geschichte. Mit 39 Jahren dann der Traumjob: Die "Vogue" nach Polen bringen.
Die Idee, sich vor den Palast zu stellen, kam von Malgosia Bela, dem Covermodel. Niedenthal engagierte Juergen Teller fĂŒr das Shooting. Die Provokation begann schon da: Ein deutscher Fotograf fotografiert ein sowjetisches GebĂ€ude - und das soll die "Vogue" Polen sein. "Ich hĂ€tte es vermutlich besser wissen sollen, aber mir war nicht klar, dass wir so sensibel sind als Nation", sagt Niedenthal. Er habe auf etwas vertraut, das fĂŒr ihn zutiefst polnisch sei: Selbstironie. "In Polen ist die FĂ€higkeit, ĂŒber die AbsurditĂ€t der eigenen Situation zu lachen, sehr ausgeprĂ€gt." Zu diesem Humor zĂ€hlen zum Beispiel Schnee statt BlĂŒmchen auf der FrĂŒhlingsausgabe einer Modezeitschrift.
Die Reaktionen auf das Cover waren heftig, Niedenthal erinnert sie als nötige Auseinandersetzung ĂŒber Polens Selbstbild: "Wir wollen als Teil Westeuropas gesehen werden und werden nicht gern daran erinnert, dass das nicht immer so war." FĂŒr Niedenthal ist diese Vergangenheit nichts, fĂŒr das man sich schĂ€men mĂŒsste. "Wie Malgosia und Anja da stehen, zeigt fĂŒr mich StĂ€rke, Selbstbewusstsein und ein völliges Fehlen von RĂŒhrseligkeit. Den Palast hinter ihnen haben wir von einem Symbol der UnterdrĂŒckung zu einem Symbol der Subversion gemacht."
Der Streit ums Cover ist erst sechs Jahre her, doch fĂŒr Niedenthal wirkt es, als habe inzwischen eine andere Zeit begonnen. Auch weil nicht mehr eine Regierung an der Macht ist, die stĂ€ndig ein KulturkampfgefĂŒhl anheize. Und weil neben dem Palast nun das Museum fĂŒr Moderne Kunst entsteht, weil der Vorplatz langsam seine MilitĂ€rparadenaura verliert. "Der Palast verschwindet im Hintergrund", sagt Niedenthal. Und das sei gut so.
Im Mai dieses Jahres stellten sich Malgosia Bela und Anja Rubik noch einmal vor den Kulturpalast, in derselben Pose lĂ€ssiger UnberĂŒhrbarkeit. Auf ihren weiĂen T-Shirts stand in rot "9. Juni". Das Datum der Europawahl. Bela postete das Foto auf Instagram, als Aufruf das Stimmrecht zu nutzen. Der Turm, ein Influencer.