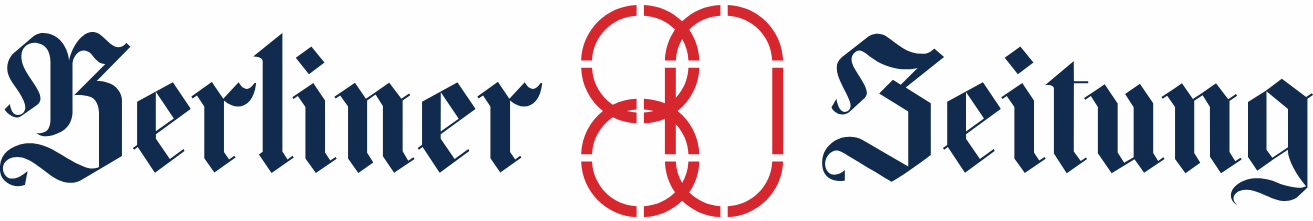Mauerfall 09.11.1989 - und was dann?

08.11.2025 , 16:25 Uhr

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung
Das Jahr zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung wurde oft beschrieben. Aber das genaueste, schonungsloseste Zeugnis war lange kaum bekannt. Es ist das Buch "Das letzte Jahr", geschrieben von Martin Gross, einem Westdeutschen, der im Januar 1990 nach Dresden gezogen war. Sein Bericht bricht mit dem Mythos, das Jahr der Wiedervereinigung sei vor allem eine Phase der Euphorie, des Freiheitsrausches f├╝r die Ostdeutschen gewesen. Und es ist sicher kein Zufall, dass es damals niemand lesen wollte und es erst drei Jahrzehnte sp├Ąter wiederentdeckt wurde - durch den Ostdeutschen Jan Wenzel, der f├╝r Recherchen zu einem eigenen Buch darauf stie├č.

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung
Sechs Jahre ist das her. Martin Gross steht im Regen auf dem Bahnhof von Bienenb├╝ttel, einer Gemeinde in Niedersachsen. Sein Haar ist grau, sein Gesicht jungenhaft. Auf der Fahrt in sein Dorf erz├Ąhlt er, wie ├╝berrascht er von der Wiederentdeckung seines Buches war. Dass er es erst noch einmal selbst lesen musste, um zu wissen, was er damals in Dresden alles erlebt hatte.
Sein Haus steht zwischen einer Pferdekoppel und einem Teich. Er wohnt allein hier, aber heute ist seine Familie zu Besuch. Samuel, sein Sohn, kocht Espresso. Christine Garbe, seine Ex-Frau, stellt Kuchen auf den Tisch, setzt sich dazu, manchmal erg├Ąnzt sie seine Erinnerungen durch ihre.
Herr Gross, wie sind Sie auf die Idee gekommen, im Januar 1990 in den Osten zu ziehen?
Meine Frau ist in Dresden geboren. Ihre Familie ist 1955 in den Westen gegangen, aber ihre Verwandtschaft war noch da. Im Dezember 1989 haben sie uns in West-Berlin besucht und gesagt, kommt doch mal r├╝ber. Und wir haben gesagt, gut, dann kommen wir im Januar f├╝r ein paar Tage.
Christine Garbe: Beim ersten Besuch war ich dabei. Wir haben bei einer fr├╝heren Nachbarin gewohnt, ein bisschen au├čerhalb. Von da aus sind wir in die Stadt gezogen. Da hat es dich gepackt.

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung
Was hat Sie gepackt, Herr Gross?
Das alles von Nahem zu erleben, zu sehen, was noch ├╝brig ist von dieser friedlichen Revolution. Erst wollte ich nur einen Artikel f├╝r die Zeitschrift Lettre International schreiben, hatte dann aber das Gef├╝hl, noch viel mehr beschreiben, noch l├Ąnger bleiben zu wollen.
Weil so viel passierte?
Ja, alles ver├Ąnderte sich rasend schnell. Jede Woche passierte was Neues. Im M├Ąrz fanden die Wahlen statt, die wollte ich mir unbedingt noch ansehen. Danach war klar, dass demn├Ąchst die W├Ąhrungsunion kommen w├╝rde. Ich dachte, das nehme ich auch noch mit. Und sehr schnell absehbar war dieser irre Zusammenbruch, den man im Westen gar nicht mitbekam. Ich dachte, im Osten gibt es jetzt einen riesigen Aufbruch. Dabei war es ein riesiger Abbruch. Und der Aufschwung fand im Westen statt.
Christine Garbe: Ich habe Martin immer wieder in Dresden besucht, und er hat mir Briefe nach Berlin geschrieben. Wir waren schockiert, wie schnell der Westen im Osten einfiel. Mit diesen unglaublich brutalen Methoden.
Sie waren ├╝berall ganz dicht dabei, Herr Gross. Im Krankenhaus, in der Redaktion einer Zeitung, in der ehemaligen Stasizentrale. Wie haben Sie das geschafft?
Durch die Kontakte meiner Frau, ihre Onkel und Tanten. Ich war in Dresden, aber auch in Magdeburg. Christines Bruder ist Dermatologe, und er hatte Kontakt in die Klinik. Ohne ihn w├Ąre ich dort nicht reingekommen.
Also war es leicht f├╝r Sie, mit den Menschen ins Gespr├Ąch zu kommen?
Ja, die Menschen damals in dieser Situation waren sehr offen. Es gab einen gro├čen Gespr├Ąchsbedarf. Da war etwas geschehen, ├╝ber das man reden musste, unbedingt reden, reden, reden, und sei es mit dem dahergelaufenen Wessi. Aber die Gespr├Ąchsbereitschaft ist dann allm├Ąhlich verstummt, einer Entt├Ąuschung gewichen.

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung
Wurden Sie immer gleich als Westdeutscher erkannt?
Ja, immer. An der Westkleidung, an der Art, Gespr├Ąche zu f├╝hren. Ich habe die Unterschiede an einer Stelle im Buch ganz brutal formuliert.
Westdeutsche tragen ihren Bauch stramm voraus, schreiben Sie. Und die Ostdeutschen beschreiben Sie als unbeholfen. Sie wollen nicht auffallen, nichts falsch machen.
Genau. Den ostdeutschen Journalisten, die ich in Dresden kennenlernte, fiel es zum Beispiel schwer, einfach Knall auf Fall eine Frage zu stellen, sie sind auf Umwegen dahin gekommen, haben erstmal die Stimmung und die Interessen ihres Gespr├Ąchspartners sondiert, bevor sie mehr aus sich herausgegangen sind. Ich fand dieses Bescheidene, Zur├╝ckgenommene angenehmer als die lauten, selbstbewussten Westjournalisten oder Westpressesprecher.
Viele Westjournalisten sind damals in den Osten gekommen, waren aber auch schnell wieder weg. Hatten Sie Kontakt zu ihnen?
Nein, ich war ganz f├╝r mich, hatte eher Kontakt zu DDR-Journalisten, zu Uta Dittmann zum Beispiel, die am 10. Oktober 1989 in ihrer Zeitung, der "Union", ├╝ber die Zusammenst├Â├če zwischen Polizei und Demonstranten am Dresdner Hauptbahnhof berichtet hatte - und zwar nicht als rowdyhafte Ausschreitungen, sondern als B├╝rgerprotest. Durch die Gespr├Ąche in ihrer Redaktion bekam ich sehr intime Einblicke, da hat es mich wirklich gepackt.

Martin Gross
geboren 1952, wuchs in B├Âblingen auf, zog kurz vor dem Abitur nach West-Berlin. Er studierte Germanistik und Politologie, arbeitete als Lehrbeauftragter an der FU, schrieb einen Roman und Texte f├╝r Zitty und taz. 1990 zog er nach Dresden und Magdeburg und schrieb "Das letzte Jahr". Von 1998 bis 2016 arbeitete er f├╝r verschiedene Universit├Ąten in Kooperationen mit russischen, indischen und europ├Ąischen Partnern. 2019 entdeckte Jan Wenzel Gross' Buch "Das letzte Jahr". 2020 wurde es im Verlag Spector Books neu aufgelegt und verkaufte seitdem rund 4000 Exemplare. Gross schrieb wieder Romane: "Ein Winter in Jakuschevsk" und "Nadjas Geschichte".
Inwiefern?
Uta Dittmann war die erste Journalistin im Osten, die sich getraut hat, so einen Bericht zu ver├Âffentlichen. Vor diesem Hintergrund sind Hans Modrow, der ehemalige SED-Bezirkschef in Dresden, und Wolfgang Berghofer, der damalige B├╝rgermeister, auf die Demonstranten zugegangen. Die Polizei hat sich von nun an zur├╝ckgehalten, es gab keine Verhaftungen mehr und auch nicht mehr diese ├╝blen Verfahren in der Haftanstalt und so weiter. Das im Detail zu beschreiben, hat mich interessiert, das Leben einer Person ├╝ber ein ganzes Jahr zu verfolgen. Auch die Konflikte in der Redaktion der "Union", die ja zu DDR-Zeiten eine CDU-Parteizeitung war.
Erinnern Sie sich noch an einen dieser Konflikte?
Ja, es gab dort ein gro├čes Misstrauen den Ost-CDUlern gegen├╝ber. Menschen, die zu den Reformern z├Ąhlten, st├╝tzten sich lieber auf Helmut Kohl als auf ihre eigenen Leute. Das war f├╝r mich ein bisschen befremdlich. Denn Kohl war ja nicht gerade eine Person, die f├╝r Erneuerung stand. Aber die ostdeutschen Reformer wollten Kohl und seine Mannschaft, weil sie eben ihren eigenen Leuten nicht getraut haben. Das hatte auch mit den ganzen Stasienth├╝llungen zu tun. Beim Demokratischen Aufbruch Wolfgang Schnur, bei der ostdeutschen SPD Ibrahim B├Âhme. Viele unserer Bekannten haben gesagt: Bevor wir eine Partei w├Ąhlen, in der dann doch wieder die Stasi mit sitzt, nehmen wir lieber den Westen.
Uta Dittmann arbeitete dann aber nicht mehr lange bei der "Union", erf├Ąhrt man aus Ihrem Buch.
Das hatte mit einem anderen Konflikt zu tun. Sie stellte sich eine Zeitung vor, in der gestritten und reflektiert, die lang erk├Ąmpfte Meinungsfreiheit ausgekostet wird. Aber dann kam der Westverlag, in dem Fall war es der S├╝ddeutsche, und der kommissarisch eingesetzte Chefredakteur sagte, ihr k├Ânnt schreiben, was ihr wollt, Hauptsache, der Artikel ist um 16 Uhr fertig und es gibt Fotos dazu und keine Bleiw├╝ste. Das, was Uta Dittmann gegen ihre Chefs durchgek├Ąmpft hatte, die eigene Meinung zu schreiben, Debatten zu f├╝hren, war nicht mehr wichtig. Das hat sie unendlich entt├Ąuscht und frustriert. Sie hat sich zur├╝ckgezogen.

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung
Auch Ihre Entt├Ąuschung ist beim Lesen Ihrer Schilderungen oft zu sp├╝ren. Woher kam die?
Aus meinen Erwartungen. Es war eine Revolution, und dann auch noch eine in Deutschland. Sowas gibt es ja nicht oft. Aber als ich in Dresden ankam, war von der Revolution nicht mehr viel ├╝brig geblieben.
Was war noch ├╝brig?
Der Runde Tisch, an dem es darum ging, die Kultur in Dresden zu organisieren. Aber auch das war entt├Ąuschend. Es hie├č, nun macht mal Vorschl├Ąge, wie es weitergeht, aber wir haben leider noch kein Telefon, ihr m├╝sst sie uns mit der Post schicken. Zu dem Zeitpunkt war bereits klar: Der Westen kommt, schickt seine Beamten, um seine Konzepte von Kulturpolitik mit den k├╝nftigen B├╝rgermeistern besprechen. Alles sollte nach Westvorbild aufgebaut und strukturiert werden. Steuer, Stadtplanung, Baugenehmigungen. Das war keine Revolution mehr, das war eine gewendete Revolution.
Christine Garbe: Das beschreibst du ja auch gut, dass zweitklassige Leute aus der alten Bundesrepublik pl├Âtzlich Leitungspositionen im Osten hatten. Das habe ich auch an den Universit├Ąten erlebt.

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung
So ein Westprofessor kann sich hier nochmal in seinem ganzen Glanz pr├Ąsentieren, schreiben Sie. Ein Satz, wie man ihn selten h├Ârt.
Die Arroganz, mit der der Westen wirklich alles niedergemacht hat, was ostdeutsch war - damit waren wir ├╝berhaupt nicht einverstanden. Der Westen war als System gewollt, und seine Leute konnten pl├Âtzlich im Osten eine unglaubliche Karriere machen. Ich habe bei meinen Recherchen einen Filialleiter eines Supermarkts getroffen, der gerade noch ein kleiner Angestellter in D├╝sseldorf war und jetzt ein Riesenzelt auf einem matschigen Gel├Ąnde aufgebaut hatte, das von f├╝nf Sattelschleppern pro Tag beliefert wurde. Er hatte nicht mal eine Genehmigung daf├╝r, die Waren wurden einfach nur abgeladen, nicht mal mehr in Regale sortiert. "Was glaubst du, was das f├╝r eine Chance ist", sagte der zu mir. "In ein paar Jahren bin ich ganz oben." Die Freiheit, die sich die Ostdeutschen erk├Ąmpft hatten, war eben vor allem f├╝r die Westler ein Freiheitsrausch.
Gibt es eigentlich so eine Art Unrechtsbewusstsein bei Westdeutschen?
Also ich kenne niemanden. Die Ostperspektive ist gar nicht im Bewusstsein der Westdeutschen gelandet, die Erkenntnis, dass es sich um einen raffgierigen Fr├╝hkapitalismus, wirklich ganz rohen, brutalen Kapitalismus gehandelt hat.
Aber Sie haben das erkannt, schreiben, die Kolonnen von Lastwagen transportieren die Arbeitslosigkeit in den Osten. Haben Sie sowas auch mal zu einem Mann wie diesem Filialleiter gesagt?
Nein. Ich habe ihn ausgefragt. Ich wollte ja seine Sicht kennenlernen und dar├╝ber schreiben k├Ânnen.
Und hatten Sie manchmal das Bed├╝rfnis, die Ostdeutschen in ihrem Kaufrausch wachr├╝tteln zu wollen, sie zu warnen?
Ja, ich habe es auch versucht. Aber f├╝r Leute wie Christines Onkel war ich ein Schwarzmaler. Er hat gesagt, bei euch im Schwarzwald sind alle Stra├čen asphaltiert, die H├Ąuser beleuchtet, die Warenangebote stimmen, und du bist hier der Miesepeter. Leute wie er wollten so leben wie wir. Ich musste st├Ąndig ihre Fragen beantworten. Welche Versicherungen sie brauchen: Vollkasko, Teilkasko, ADAC? Welche Steuerklasse, drei oder f├╝nf?
Christine Garbe: Sie haben ja nicht gesehen, was auf sie zukommt, die Treuhand, die westliche Konkurrenz, der Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft, die Massenarbeitslosigkeit. Von einem Tag auf den anderen war ihnen die Existenzgrundlage entzogen. So etwas hatten wir bei uns im Westen noch nie erlebt.

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung
H├Ątte man das Ihrer Meinung nach verhindern k├Ânnen?
Martin Gross: Schwer zu sagen. Die ganze Wendezeit stand unter einem enormen Zeitdruck, es sollte verhindert werden, dass noch mehr Leute abhauen. Bei einer Montagsdemo in Dresden haben mir Jugendliche gesagt, also wenn die D-Mark nicht sofort kommt, dann sind wir weg hier. Klar, der Westen hat die DDR geschluckt. Aber es waren nat├╝rlich auch die Ostdeutschen selbst, die den Westen wollten und keine Interesse hatten, wie Polen, Rum├Ąnien oder Ungarn ein eigenes System, einen eigenen souver├Ąnen Staat aufzubauen. Und als mit den Wahlen klar war, sie wollen das westliche System, kamen aus dem Westen eben die Leute, die sich damit auskannten. Man h├Ątte den Ostdeutschen nicht so viel Hoffnung machen sollen, stattdessen das Bewusstsein daf├╝r sch├Ąrfen, dass es eine schwierige Situation wird. Und darauf achten, dass man sie mit einbindet in die neuen Strukturen.
Im Januar 1991 haben Sie Dresden verlassen. Als 1992 Ihr Buch "Das letzte Jahr" erschien, waren Sie wieder im Westen. Wie haben Sie das erlebt?
Mein Buch ist erschienen, als unser Sohn Samuel geboren wurde, im Oktober '92. Wir lebten wieder im Schwarzwald, wo ich herkomme, und waren geistig ganz woanders. Es gab eine einzige Rezension, in der taz, ansonsten hat mein Buch keinen Menschen interessiert. Das Thema war im Westen abgegessen, weil die Ostdeutschen ja angeblich sowieso nur jammerten. Und die Ossis wollten sich nicht mehr an ihre Hoffnungen und Entt├Ąuschungen von vor zwei Jahren erinnern. Es hie├č, Martin Gross erz├Ąhlt nur das, was wir l├Ąngst wissen.
Es sind dann drei├čig Jahre vergangen, bis Ihr Buch entdeckt wurde. In der Zwischenzeit haben Sie kein einziges mehr geschrieben. Warum nicht?
Naja, es gab die Familienphase, und ab 1998 stand f├╝r mich Russland im Vordergrund.

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung
Russland?
Wir waren inzwischen hierhergezogen, in die N├Ąhe von L├╝neburg, wo meine Frau eine Professur hatte. Es gibt hier sehr viele Deutschrussen und einen B├╝rgerverein, der eine Partnerschaft mit einer russischen Stadt in die Wege leiten wollte. Es wurde f├╝r die dortige Uni ein Gastdozent f├╝r das Fach Deutsch gesucht, und ich war neugierig darauf, Russland hautnah zu erleben, auch mit dem Hintergrund, noch einmal eine Wendezeit zu erleben. Diesmal wollte ich aber nicht mehr der skeptische Beobachter sein, sondern mithelfen, die Demokratie aufzubauen. Die EU hatte riesige Programme f├╝r Hochschulkooperationen mit Russland. Ich dachte, das ist eine einmalige Chance. Aber ja, es hat nicht funktioniert, man sieht ja heute das Ergebnis.
Warum hat es nicht funktioniert?
Im Nachhinein w├╝rde ich sagen, es war ein fundamentales Missverst├Ąndnis, dass Russland wirklich von Demokratie, Zivilgesellschaft, Rechtsstaatlichkeit, Parteienvielfalt begeistert war. Die Begriffe "Demokratie", "Marktwirtschaft" usw., standen aus russischer Sicht f├╝r die Katastrophenjahre unter Jelzin: Oligarchenkriege und Korruption. 1998 war das schw├Ąrzeste Jahr in der russischen Geschichte. Der Rubelkurs rutschte tief in den Keller, es gab die ├ľlkrise, der Staatshaushalt war pleite. Die H├Ąuser waren Ruinen, noch viel schlimmer als in Dresden. Arbeit, Wohnen, medizinische Versorgung, alles war zusammengebrochen, alles ohne Absicherung. Und dann kamen wir und wollten den Russen die Vorteile der Demokratie erkl├Ąren. Es hat st├Ąndig gekracht.
K├Ânnen Sie ein Beispiel erz├Ąhlen?
Deutsche Journalistikstudenten haben eine russische Zeitung besucht. Eine ihrer Fragen war: Wer ist eigentlich der Eigent├╝mer dieser Zeitung, wem geh├Ârt sie? Und die zweite Frage: Wir haben geh├Ârt, dass die Zeitung sich auch dadurch finanziert, dass Politiker f├╝r ihre Interviews bezahlen. Am Abend bekam ich den Anruf von Nina, einer russischen Kollegin: Ihr seid doch G├Ąste, sowas fragt man doch nicht. Der Zeitungstermin f├╝r den n├Ąchsten Tag wurde dann gestrichen. Ein anderes Mal wurden deutsche Studenten durch den russischen Rektor verabschiedet, aber die russischen Studenten, bei denen sie gewohnt haben, sollten nicht dabei sein. Die Deutschen haben gesagt: "N├Â, da kommen wir auch nicht". Das war nat├╝rlich arrogant von ihnen. Und ich verstehe Russen, wenn sie nach solchen Erfahrungen, die sie auch mit mir gemacht haben, sagen: Der Westen will uns bevormunden. Das war so.
Was meinen Sie mit: Erfahrungen, die Russen auch mit Ihnen gemacht haben?

Paulus Ponizak/Berliner Zeitung
Weil von EU-Seite die F├Ârderung von Kooperationen auf "Problem-Themen" konzentriert war, habe ich mich ├╝berall reingeh├Ąngt: in die Arbeit mit schwierigen Jugendlichen und schwer Heroins├╝chtigen. Ich war in Waisenh├Ąusern, auch im Knast. Dass da jemand so sehr in ihren "Schmuddelecken" herumst├Âbert, war f├╝r die Russen schwer zu ertragen. 2002 wurde mir das Visum weggenommen und ein paar Jahre sp├Ąter, als ich wieder eins hatte, nochmal. Ich war eine unerw├╝nschte Person und habe dann nat├╝rlich ├╝berlegt: Was ist da schiefgegangen? Die, mit denen ich in Kontakt bin, haben mir gesagt: Du bist zu offensiv gewesen, zu fordernd. Und es stimmt ja auch. Wir hatten die Vorstellung, Demokratie sieht so und so aus, die Russen wollten aber unser System gar nicht, haben gesagt, wir haben unser eigenes.
Sie haben immer noch Kontakt zu ihnen, auch jetzt, w├Ąhrend des Krieges?
Ja, ich bin ersch├╝ttert ├╝ber Putins Krieg, nichtsdestotrotz bin ich ein Freund der Russen und schreibe mir mit einigen Kollegen, und sie schreiben mir.
Was schreiben sie Ihnen?
"Lieber Martin, wir sind traurig." Oder: "Wir machen uns gro├če Sorgen." Ohne zu sagen, wor├╝ber sie sich Sorgen machen. Andere schreiben: "Lieber Martin, du hast uns von Anfang an nicht verstanden, wir k├Ąmpfen hier um Leben und Tod". Und dann frage ich mich nat├╝rlich: Schreiben sie so, weil sie das wirklich denken, oder weil sie diejenigen f├╝rchten, die insgeheim ihre E-Mails mitlesen? "Wir beten daf├╝r, dass es besser wird", stand in einem Brief; von Krieg war keine Rede.
Sind die Entfremdung zwischen Ost- und Westdeutschen, der Aufstieg der AfD, f├╝r Sie Entwicklungen, die aus den Fehlern der Vergangenheit resultieren?
In den gro├čen Z├╝gen, ja. Sie sagen auf diese Art: Wir wollen euer System nicht, wir machen das lieber selber. Es war ein Fehler, DDR-B├╝rger nicht mehr einzubeziehen beim Aufbau des westlichen Systems. Man hat sie verwaltet, aber nicht mit aktiviert. Und das zahlt sich massiv aus.

Vor fast genau 35 Jahren haben Sie ├╝ber die Ostdeutschen geschrieben: "Schade, wenn ich diese Leute sehe, wie sich alles f├╝r sie ├Ąndert, denke ich, warum nur sie? Warum haben nicht auch wir die Chance, noch einmal alles zu ├Ąndern?" Denken Sie das heute noch?
Heute sehe ich keine gro├če Chance, etwas zu ├Ąndern. Man kann eigentlich nur Millimeterarbeit leisten, im Sinne der Verst├Ąndigung mit denen, die entt├Ąuscht sind.
Ihre St├Ąrke ist es, immer die Perspektive der anderen verstehen zu wollen. Wo haben Sie das gelernt?
Ich wei├č nicht. Vielleicht hat es damit zu tun, dass beide meiner Eltern praktisch geh├Ârlos waren. Da spielte es eine gro├če Rolle, den anderen jenseits von Worten zu verstehen.
Wie war das f├╝r Sie, als Ihr Buch wiederentdeckt wurde?
Ich bin aufgelebt, habe wieder geschrieben und publiziert, auch ├╝ber meine Zeit in Russland. Das war f├╝r mich vor 20 Jahren nicht abzusehen, das ist ein neues sch├Ânes Lebensgef├╝hl.
Haben Sie noch Kontakt zur Ostverwandtschaft in Dresden?
Die Dresdner leben nicht mehr. Aber zu einem Ost-Journalisten von damals habe ich noch Kontakt. In meinem Buch habe ich in "Stefan" genannt. Er hat mich neulich besucht und wir haben ├╝berlegt, ob wir eine Fortsetzung vom "Letzten Jahr" schreiben sollten.
Wo w├╝rden Sie heute hingehen, um ein Buch ├╝ber so gro├če gesellschaftliche Ver├Ąnderungen zu schreiben?
Wieder in den Osten, klar.